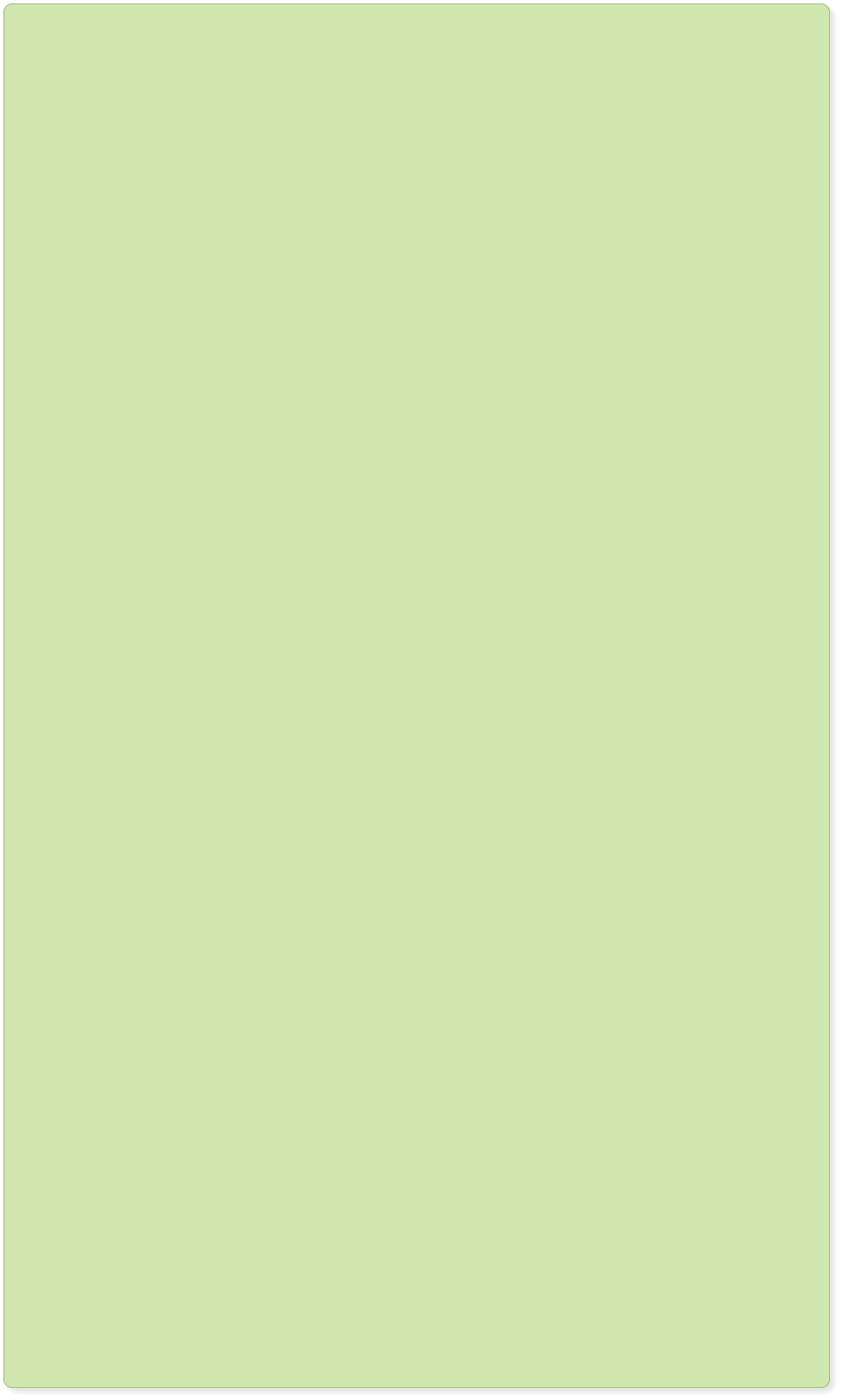
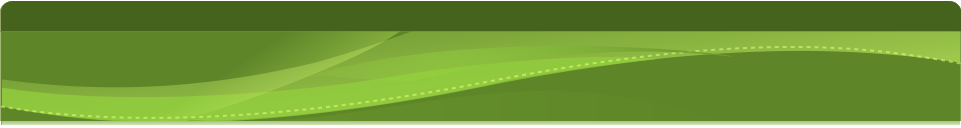
Unter den Schwimmkäfern (Dytiscidae) finden sich mit dem Breitrand (Dytiscus latissmius) und
dem Schmalbindigen Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) zwei Arten, die in den
Anhängen II und IV der FFH- Richtlinie aufgeführt sind. Somit müssen für die Art besondere
Schutzgebiete ausgewiesen werden. Des Weiteren ist die Art im Anhang II der Berner Konvention
gelistet. In Deutschland ist der Käfer nach dem BNatSchG streng geschützt.
Beide Arten zeigen ähnliche Habitatansprüche, da sie oftmals gemeinsam gefunden werden. Beide Arten besiedeln größere nährstoffarme, makrophytenreiche Flachseen mit breitem Verlandungsgürtel. Außerhalb des Winters bevorzugen sie die Verlandungs- bzw. Flachwasserzone mit dichter emerser Vegetation (z.B. Carex, Schoenoplectus). Das Spektrum der besiedelten Gewässer ist umfangreich: es gibt Nachweise dieser Art u.a. aus sauberen Klarwasser- und Braunwasserseen mit hohem Huminsäuregehalt, eutrophen u./o. dystrophen Gewässern, Fischteichen, Moorweihern, Torfstichen, Kies- und Kohlengrubengewässern, Altwässern. Neben natürlich entstandenen Gewässern können sie auch in anthropogen entstandenen Gewässern vorkommen. Oftmals sind die Gewässer in Waldgebieten gelegen. Die Gewässer sind meist größer als 1 ha und mindestens 1 m tief; Graphoderus bilineatus besitzt geringere Raumansprüche und besiedelt auch kleinere Gewässer. Beide Arten tolerieren sehr saures Wasser. Besonnte, flache und vegetationsreiche Uferabschnitte in den Teilbereichen eines Gewässers sind vor allem für die Larvenentwicklung beider Arten wichtig. Im Rahmen des landesweiten Artenmonitorings der FFH-Arten in MV gelangen auch Neunachweise der Art. Zudem wurden die bekannten Vorkommen in Brandenburg einer Überprüfung unterzogen und darauf aufbauend ein landesweiter Managementplan für die beiden Arten erstellt. Jahrelange Erfahrungen zeigten, dass eine Notwendigkeit besteht, an visuell potenziell geeigneten, verschiedensten Gewässern Übersichtsbegehungen und Testbereusungen durchzuführen. Erst im Anschluss sollten potenzielle Habitatgewässer ausgeschieden und fortführende Detailerhebungen, Habitaterfassungen und Vegetationskartierungen erfolgen, um mögliche Vorkommen feststellen zu können. Eine Erfassung der Wasserkäfer erfolgt mittels Reusenfallen. Zum Einsatz kommen: • Flaschenreusenfallen (Modell Vittel) Die Flaschen werden über Nacht ufernah möglichst innerhalb der Gewässervegetation innerhalb der Flachwasserbereiche ausgebracht. Diese Fallen werden mittels Schweineleber, Katzenfutter und Fischfuttertabletten beködert. Um ein Überleben der Käfer und weiterer Tierarten (z.B. weitere Wasserinsekten, Amphibien, Reptilien) zu gewährleisten, wird in den Flaschen eine Restluftmenge (Luftblase) belassen. Die Zahl der ausgelegten Fallen liegt in der Regel bei 10- 20 Flaschen je untersuchten Teilbereich. An kleinen Gewässerbereichen ist eine geringere Flaschenzahl ausreichend. • Molchkorbreusen (Modell Henf) Der Einsatz der Molchreusen erfolgt ergänzend zu den Flaschenreusenfallen. Auf Grund der Größe ist es jedoch meist schwierig, sie am unmittelbaren Ufer zu stationieren. Deshalb erfolgt der Einsatz meist in etwas tieferen Bereichen mit Wasservegetation. Auch hier kommen Schweineleber und Katzenfutter als Köder zum Einsatz. Zusätzlich werden den Fallen zur Erhöhung der Effektivität Knicklichter zugegeben, um eine optische Lockwirkung zu erzeugen. Auch die Molchreusen werden über Nacht ausgebracht. Die Zahl der eingesetzten Molchreusen umfasst zumeist drei bis fünf Fallen je Gewässer. • Unterwasser- Lichtfallen Ein Einsatz der Unterwasser- Lichtfallen erfolgt analog zu den Molchreusen. Der Hauptunterschied zwischen beiden Reusentypen liegt in der Art der Lichtquelle. Diese ist bei den Lichtfallen heller, da solarbetriebene Wegelampen eingebaut sind. Die Zahl der eingesetzten Lichtfallen umfasst im Normalfall ein bis drei Fallen pro Gewässer. Neben der Bereusung erfolgt an relevanten Gewässern zusätzlich eine Bekescherung vor allem der Vegetations- und Uferbereiche. Das entnommene Material wird direkt im Anschluss in weiße Fotoschalen überführt und Belegtiere für die Artbestimmung in Ethanol fixiert. Neben den Käfererfassungen werden verschiedener Habitatparameter (z.B. pH- Wert, elektrische Leitfähigkeit, Gewässerstruktur, evt. Schadstoff-Einträge, vorherrschende Nutzungs- und Bewirtschaftungsformen) registriert.Wasserkäfer

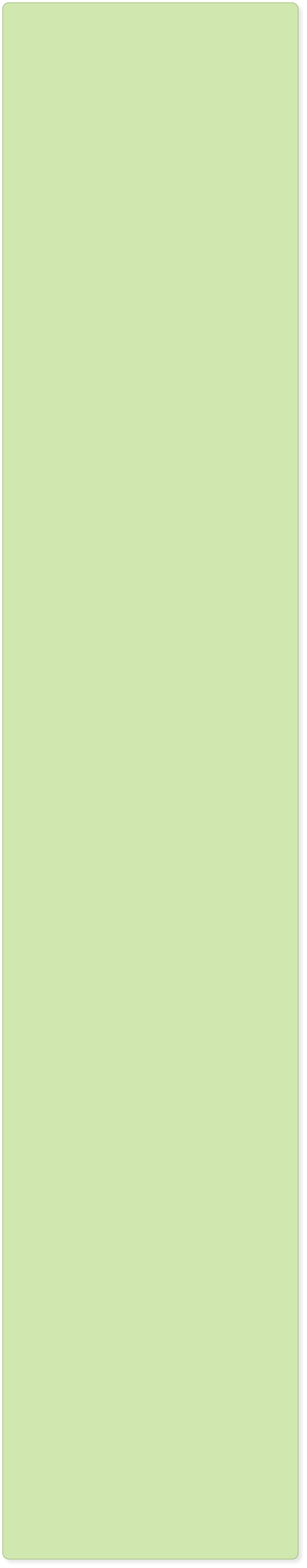

Unter den Schwimmkäfern
(Dytiscidae) finden sich mit dem
Breitrand (Dytiscus latissmius) und
dem Schmalbindigen Breitflügel-
Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus)
zwei Arten, die in den Anhängen II
und IV der FFH- Richtlinie aufgeführt
sind. Somit müssen für die Art besondere Schutzgebiete
ausgewiesen werden. Des Weiteren ist die Art im Anhang II der
Berner Konvention gelistet. In Deutschland ist der Käfer nach
dem BNatSchG streng geschützt.
Beide Arten zeigen ähnliche Habitatansprüche, da sie oftmals gemeinsam gefunden werden. Beide Arten besiedeln größere nährstoffarme, makrophytenreiche Flachseen mit breitem Verlandungsgürtel. Außerhalb des Winters bevorzugen sie die Verlandungs- bzw. Flachwasserzone mit dichter emerser Vegetation (z.B. Carex, Schoenoplectus). Das Spektrum der besiedelten Gewässer ist umfangreich: es gibt Nachweise dieser Art u.a. aus sauberen Klarwasser- und Braunwasserseen mit hohem Huminsäuregehalt, eutrophen u./o. dystrophen Gewässern, Fischteichen, Moorweihern, Torfstichen, Kies- und Kohlengrubengewässern, Altwässern. Neben natürlich entstandenen Gewässern können sie auch in anthropogen entstandenen Gewässern vorkommen. Oftmals sind die Gewässer in Waldgebieten gelegen. Die Gewässer sind meist größer als 1 ha und mindestens 1 m tief; Graphoderus bilineatus besitzt geringere Raumansprüche und besiedelt auch kleinere Gewässer. Beide Arten tolerieren sehr saures Wasser. Besonnte, flache und vegetationsreiche Uferabschnitte in den Teilbereichen eines Gewässers sind vor allem für die Larvenentwicklung beider Arten wichtig. Im Rahmen des landesweiten Artenmonitorings der FFH-Arten in MV gelangen auch Neunachweise der Art. Zudem wurden die bekannten Vorkommen in Brandenburg einer Überprüfung unterzogen und darauf aufbauend ein landesweiter Managementplan für die beiden Arten erstellt. Jahrelange Erfahrungen zeigten, dass eine Notwendigkeit besteht, an visuell potenziell geeigneten, verschiedensten Gewässern Übersichtsbegehungen und Testbereusungen durchzuführen. Erst im Anschluss sollten potenzielle Habitatgewässer ausgeschieden und fortführende Detailerhebungen, Habitaterfassungen und Vegetationskartierungen erfolgen, um mögliche Vorkommen feststellen zu können. Eine Erfassung der Wasserkäfer erfolgt mittels Reusenfallen. Zum Einsatz kommen: • Flaschenreusenfallen (Modell Vittel) Die Flaschen werden über Nacht ufernah möglichst innerhalb der Gewässervegetation innerhalb der Flachwasserbereiche ausgebracht. Diese Fallen werden mittels Schweineleber, Katzenfutter und Fischfuttertabletten beködert. Um ein Überleben der Käfer und weiterer Tierarten (z.B. weitere Wasserinsekten, Amphibien, Reptilien) zu gewährleisten, wird in den Flaschen eine Restluftmenge (Luftblase) belassen. Die Zahl der ausgelegten Fallen liegt in der Regel bei 10- 20 Flaschen je untersuchten Teilbereich. An kleinen Gewässerbereichen ist eine geringere Flaschenzahl ausreichend. • Molchkorbreusen (Modell Henf) Der Einsatz der Molchreusen erfolgt ergänzend zu den Flaschenreusenfallen. Auf Grund der Größe ist es jedoch meist schwierig, sie am unmittelbaren Ufer zu stationieren. Deshalb erfolgt der Einsatz meist in etwas tieferen Bereichen mit Wasservegetation. Auch hier kommen Schweineleber und Katzenfutter als Köder zum Einsatz. Zusätzlich werden den Fallen zur Erhöhung der Effektivität Knicklichter zugegeben, um eine optische Lockwirkung zu erzeugen. Auch die Molchreusen werden über Nacht ausgebracht. Die Zahl der eingesetzten Molchreusen umfasst zumeist drei bis fünf Fallen je Gewässer. • Unterwasser- Lichtfallen Ein Einsatz der Unterwasser- Lichtfallen erfolgt analog zu den Molchreusen. Der Hauptunterschied zwischen beiden Reusentypen liegt in der Art der Lichtquelle. Diese ist bei den Lichtfallen heller, da solarbetriebene Wegelampen eingebaut sind. Die Zahl der eingesetzten Lichtfallen umfasst im Normalfall ein bis drei Fallen pro Gewässer. Neben der Bereusung erfolgt an rele- vanten Gewässern zusätzlich eine Bekescherung vor allem der Vegeta- tions- und Uferbereiche. Das entnommene Material wird direkt im Anschluss in weiße Fotoschalen über- führt und Belegtiere für die Artbestimmung in Ethanol fixiert. Neben den Käfererfassungen werden verschiedener Habitatparameter (z.B. pH- Wert, elektrische Leitfähigkeit, Gewässerstruktur, evt. Schadstoff-Einträge, vorherrschende Nutzungs- und Bewirtschaftungsformen) registriert.Wasserkäfer



- Übersicht
- Umweltverträglichkeit
- FFH-Verträglichkeit
- Artenschutzrechtliche Prüfungen
- Landschaftspflegerische Begleitpläne
- Ökologische Baubegleitung
- Managementplanung
- Monitoring und Pflegekonzepte
- Flora und Vegetation
- Avifauna
- Säugetierfauna
- Herpetofauna
- Molluskenfauna
- Entomofauna und Spinnen
- Gewässeruntersuchung




- BIOM
- Leistungen
- Übersicht
- Planungssicherheit
- Umweltverträglichkeit
- FFH-Verträglichkeit
- Artenschutzrechtliche Prüfungen
- Landschaftspflegerische Begleitpläne
- Ökologische Baubegleitung
- Managementplanung
- Monitoring und Pflegekonzepte
- Flora & Vegetation
- Avifauna
- Säugetierfauna
- Herpetofauna
- Molluskenfauna
- Entomofauna und Spinnen
- Gewässeruntersuchungen
- Schwerpunkte
- Methodik
- Referenzen
- Publikationen
- Media













