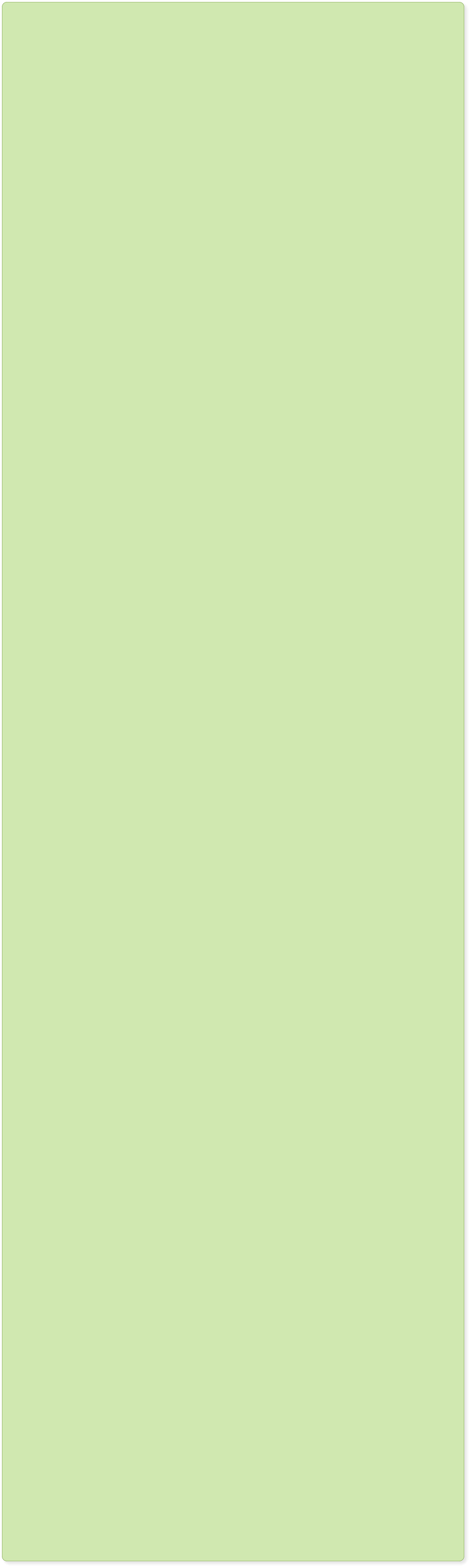
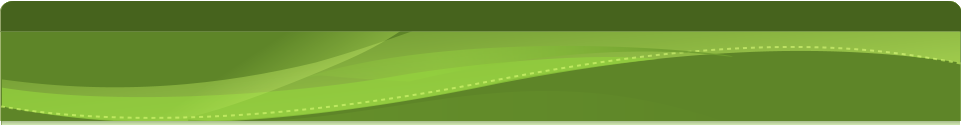
Entomofauna und Spinnen
Xylobionte Käfer Mittlerweile sind Untersuchungen zu xylobionten Käfern vor allem im Rahmen von Speziellen Artschutzrechtlichen Fachbeiträgen insbesondere im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheitspflicht zu einem Arbeitsschwerpunkt geworden. Auch im Rahmen von Managementplanungen sowie landes- bzw. bundesweiten Monitoringprogrammen kommt dieser Gruppe eine immer höhere Bedeutung zu. Mit z.T. speziellen Erfassungs- und Auswertemethoden, beispielsweise dem Einsatz von Pheromonen zum Nachweis einer aktuell sich reproduzierenden Population, können folgende Leistungen erbracht werden: • Untersuchungen zum Erhaltungszustand lokaler Populationen und ihrer möglichen Betroffenheit durch Vorhaben, • Vorschlägen für Vermeidungs- und Minimierungs sowie Ausgleichsmaßnahmen, • Aufzeigen und Abstimmung von Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen), • Gutachten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, • artenschutzrechtlichen Verträglichkeitprüfungen (spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen), • FFH- und Umweltverträglichkeitsprüfungen, • Fachbeiträge zum Thema "Holzkäfer" für Umweltberichte, Landschaftspflegerische Begleitpläne, sowie Managementpläne, • Ökologischen Baubegleitungen, • Umsiedlungen, Monitoring, Erfolgskontrollen, • Vorträge, Schulungen etc. Libellen Die Libellen, die vergleichsweise zu anderen Insektenordnungen eine geringe Artenzahl haben, verbringen einen Großteil ihres Lebenszyklus im bzw. am Wasser. Hierbei entwickelten sich evolutiv bedingt starke Anpassungen an verschiedenste ökologische Nischen. Der Spezialisierungsgrad ist folglich artspezifisch hoch. Als Bioindikatoren erlauben bestimmte Arten Aussagen über Lebensraumqualität und -veränderungen. Diese Gruppe stellt demzufolge eine sehr gute Indikatorgruppe für aquatische und semiaquatische Lebensräume dar. Für die Erfassung in ausgewählten relevanten Lebensräumen finden 3-6 Begehungen bei günstigen Witterungsverhältnissen zwischen Mai und September statt. Wenn keinerlei Reproduktionsräume direkt überbaut werden, wird sich lediglich auf Sichtkontrollen (evtl. mit Fernglas) und im Zweifelsfalle Streifsackfänge beschränkt. Ansonsten erfolgt die Erfassung mit habitatspezifischen Methoden, wie Sichtbeobachtungen (insbesondere Eiablage), Kescherfänge, Exuvien und Totfunde. Tagfalter/Widderchen Die Bindung der Tagfalter an bestimmte Pflanzenarten, -familien bzw. bestimmte abiotische Zusatzfaktoren erlaubt eine sehr genaue Charakterisierung der Lebensraumqualitäten. Zahlreiche Arten reagieren empfindlich auf Habitatveränderungen. Bei der Erfassung ausgewählter, feuchtgebietsspezifischer Lepidoptera finden unter günstigen Witterungsverhältnissen zumeist 6-8 Begehungen geeigneter Probeflächen, die mit Hilfe der Biotoptypenkartierung sowie guter lokaler Kenntnisse festgelegt werden, statt. Die erste Kontrolle beinhaltet neben den Sichtkontrollen sowie Streifsackfängen auch eine Raupensuche. Quantitative Erfassungen für vergleichende Statistiken werden nach der Transektmethode durchgeführt. Gelegentlich werden auch bei Tagfaltern Köderfänge durchgeführt. Nachtfalter Von den im Nordostdeutschen Tiefland ca. 800 bekannten nachtaktiven Groß- Schmetterlingsarten zeigen viele eine hohe Spezialisierung an bestimmte Nahrungspflanzen, woraus wiederum eine Gefährdung resultiert. Aufgrund dessen eignen sie sich hervorragend als Deskriptoren für die Bewertung von Strukturreichtum und Vernetzungsgrad der untersuchten Lebensräume. Bei der Erfassung von Imagines nachtaktiver Schmetterlinge kommen gewöhnlich Anlockmethoden zur Anwendung. Es handelt sich im Wesentlichen um Köder-, Pheromon- und Lichtfang. Die Fängigkeit aller diese selektiven Nachweismethoden hängt von verschiedenen methodischen, räumlichen und artspezifischen Gegebenheiten ab. Beim Lichtfang stehen der persönliche Lichtfang und der Einsatz von automatischen Lichtfallen zur Verfügung. Persönlicher Lichtfang kann mittels verschiedener Lichtquellen an Reflektorflächen oder mittels Leuchttürmen erfolgen. Beim Fallenfang ist zwischen Tötungs- und Lebendfallen zu unterscheiden. Beim Köderfang werden Köderschnüre bzw. Pinselanstriche im potenziellen Habitat ausgebracht und anschließend in regelmäßigem Abstand kontrolliert. Letztlich ist für die Arbeit mit Nachtfaltern die Präparation und das Führen einer wissenschaftlichen Vergleichssammlung unerlässlich. Heuschrecken Diese Gruppe mit in Mitteleuropa überschaubarer Artenzahl bewohnt alle Strata und ist vor allem für eine Beurteilung von Offenlandbereichen prädestiniert. Hierbei besiedeln Charakterarten sowohl trockene als auch feuchte bis nasse Extrembiotope. Da diese Gruppe artspezifisch empfindlich auf Veränderungen einzelner Parameter im Umfeld ihres Lebensraumes reagieren, eignet sie sich insbesondere zur Dokumentation möglicher Auswirkungen von Eingriffen. Für die Erfassung der Saltatoria in ausgewählten Bereichen finden drei Begehungen auf geeigneten Probeflächen bei günstigen Witterungsverhältnissen statt. Alle schon vorhandenen Daten fließen in die Auswertung ein. Die Kontrolle beinhaltet neben dem Verhören mit dem BAT-Detektor vor allem Sichtkontrollen sowie Kescherfänge. Arten, die keine oder kaum wahrnehmbare Gesänge (Dornschrecken, Eichenschrecke u. a.) äußern, werden durch Abklopfen von Büschen und Bäumen bzw. gezieltes Suchen erfasst. Laufkäfer Laufkäfer als epedaphisch (in der Streuschicht) lebende Gruppe sind eine gut untersuchte und anerkannte Bioindikatorengruppe, auf die oft bei ökologischen Untersuchungen zurückgegriffen wird. Der Bodenfallenfang ist, zumindest für epedaphische Arthropodengruppen wie die der Laufkäfer nach wie vor die günstigste Methode, um in relativ kurzer Zeit und mit vertretbarem Zeit- und Arbeitsaufwand einen annähernd genauen Überblick über den Artbestand und die Artzusammensetzung eines Gebietes zu erhalten. In Anwendung kommen Bodenfallen nach BARBER (1931). Ein im Boden verbleibender PVC- Zylinder wird mit einem Plastbecher beschickt, der das schnelle und unkomplizierte Entleeren des Falleninhaltes ermöglicht. Ein Eindringen von Regenwasser und damit ein Überlaufen der Fallen wird durch ein auf Halterungen befestigtes durchsichtiges PVC-Dach mit einem Bodenabstand von ca. 5 cm verhindert. Als Fangflüssigkeit dient Ethylenglykol. Die Bodenfallen werden je nach Standort und Problematik wahlweise in Fallengruppen zu je fünf bzw. zweimal drei Fallen angeordnet. Um eine gegenseitige Beeinflussung der Fängigkeit der Fallen zu vermeiden, werden sie mit einem Mindestabstand von mindestens 5 m voneinander aufgestellt. Eine Leerung erfolgt in einem 14-tägigen Rhythmus. Bei Lebendfallen (ohne Konservierungsflüssigkeit) wird alle drei bis vier Tage geleert. Spinnen Webspinnen sind eine anerkannte, gut erforschte Bioindikationsgruppe, die es ermöglicht in einem breiten Spektrum von Straten die Lebensraumbedingungen zu beschreiben und zu analysieren. In Mitteleuropa treten mehr als 1000 Arten mit einem hohen Anteil an stenöken Species auf. Diese hochspezialisierten Arten mit ihren artspezifischen Habitatanforderungen sind für die Bewertung von Lebensräumen und für die Eingriffs- und Raumplanung gut geeignet. Zu Erfassung und Nachweis kommen je nach Fragestellung verschiedene Methoden in Frage. Wird vor allem das epigäische (am Boden lebende) Artenspektrum betrachtet, kommt die Bodenfallenmethode (s. hierzu Laufkäfer) zum Einsatz. Die in der Kraut- und Strauchschicht lebenden Radnetzspinnen sind durch Handaufsammlungen und Sichtbeobachtungen gut zu erfassen. Eine bessere Verwertbarkeit dieser Form der Aufnahme wird durch eine semiquantitative Bearbeitung mit dem Streifnetz oder mit dem Klopfschirm möglich. Zur Abrundung des Artenspektrums können Spinnen auch am Licht als Beifänge der Schmetterlingskartierung in Lichtfallen gefangen werden. Wanzen Bekanntermaßen stellen die Wanzen in ihrer Gesamtheit weltweit die einzige Insektenordnung dar, die alle Lebensräume erobert hat. Zudem gilt sie als weltweit artenreichste hemimetabole Insektenordnung (derzeit ca. 44.000 Arten beschrieben). Ein arten- und individuenreiches Auftreten in vielen Habitaten ermöglicht eine fundierte statistische Aussage. Ein weiterer Vorteil bildet die große Agilität zahlreicher Arten. Sie sind somit in der Lage, kurzfristig sich ändernde Standortbedingungen anzuzeigen. Das Artenspektrun wird mittels Streifsack, Bodenfallen und Handauflese erfasst. Die Leerung aller Fallen erfolgt in einem dreiwöchigen Rhythmus im Zeitraum von Anfang April bis Mitte Oktober. Zusätzlich kann mit weiteren Erfassungsmethoden deren Fängigkeit ermittelt werden. So werden Fotoeklektoren, eine Malaisefalle sowie Gelbschalen gestellt und es kommt ein Klopfschirm sowie der D-Vac Sauger zur Anwendung. In witterungs- begünstigten Nächten kann zudem die Lichtfalle eingesetzt werden.
Der Juchtenkäfer (Osmoderma
eremita) - eine Handreichung für
Planungsbüros.
Die 3. Auflage ist in Vorbereitung.
Die Broschüre können Sie unter
www.osmoderma.info bestellen.
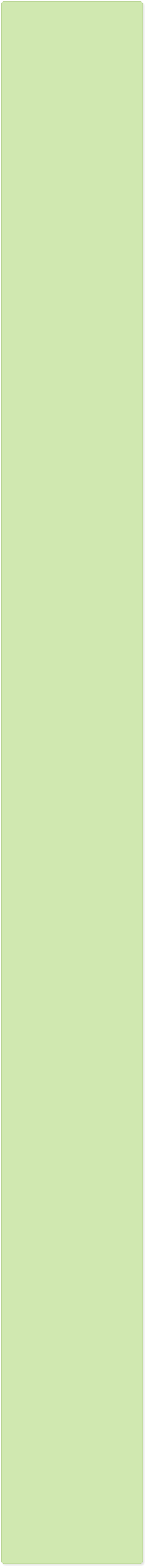

Entomofauna und Spinnen
Xylobionte Käfer Mittlerweile sind Untersuchungen zu xylobionten Käfern vor allem im Rahmen von Speziellen Artschutzrechtlichen Fachbeiträgen insbesondere im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheitspflicht zu einem Arbeitsschwerpunkt geworden. Auch im Rahmen von Managementplanungen sowie landes- bzw. bundesweiten Monitoringprogrammen kommt dieser Gruppe eine immer höhere Bedeutung zu. Mit z.T. speziellen Erfassungs- und Auswertemethoden, beispielsweise dem Einsatz von Pheromonen zum Nachweis einer aktuell sich reproduzierenden Population, können folgende Leistungen erbracht werden: • Untersuchungen zum Erhaltungszustand lokaler Populationen und ihrer möglichen Betroffenheit durch Vorhaben, • Vorschlägen für Vermeidungs- und Minimierungs sowie Ausgleichsmaßnahmen, • Aufzeigen und Abstimmung von Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen), • Gutachten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, • artenschutzrechtlichen Verträglichkeitprüfungen (spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen), • FFH- und Umweltverträglichkeitsprüfungen, • Fachbeiträge zum Thema "Holzkäfer" für Umweltberichte, Landschaftspflegerische Begleitpläne, sowie Managementpläne, • Ökologischen Baubegleitungen, • Umsiedlungen, Monitoring, Erfolgskontrollen, • Vorträge, Schulungen etc. Libellen Die Libellen, die vergleichsweise zu anderen Insektenordnungen eine geringe Artenzahl haben, verbringen einen Großteil ihres Lebenszyklus im bzw. am Wasser. Hierbei entwickelten sich evolutiv bedingt starke Anpassungen an verschiedenste ökologische Nischen. Der Spezialisierungsgrad ist folglich artspezifisch hoch. Als Bioindikatoren erlauben bestimmte Arten Aussagen über Lebensraumqualität und -veränderungen. Diese Gruppe stellt demzufolge eine sehr gute Indikatorgruppe für aquatische und semiaquatische Lebensräume dar. Für die Erfassung in ausgewählten relevanten Lebensräumen finden 3-6 Begehungen bei günstigen Witterungsverhältnissen zwischen Mai und September statt. Wenn keinerlei Reproduktionsräume direkt überbaut werden, wird sich lediglich auf Sichtkontrollen (evtl. mit Fernglas) und im Zweifelsfalle Streifsackfänge beschränkt. Ansonsten erfolgt die Erfassung mit habitatspezifischen Methoden, wie Sichtbeobachtungen (insbesondere Eiablage), Kescherfänge, Exuvien und Totfunde. Tagfalter/Widderchen Die Bindung der Tagfalter an bestimmte Pflanzenarten, -familien bzw. bestimmte abiotische Zusatzfaktoren erlaubt eine sehr genaue Charakterisierung der Lebensraumqualitäten. Zahlreiche Arten reagieren empfindlich auf Habitatveränderungen. Bei der Erfassung ausgewählter, feuchtgebietsspezifischer Lepidoptera finden unter günstigen Witterungsverhältnissen zumeist 6-8 Begehungen geeigneter Probeflächen, die mit Hilfe der Biotoptypenkartierung sowie guter lokaler Kenntnisse festgelegt werden, statt. Die erste Kontrolle beinhaltet neben den Sichtkontrollen sowie Streifsackfängen auch eine Raupensuche. Quantitative Erfassungen für vergleichende Statistiken werden nach der Transektmethode durchgeführt. Gelegentlich werden auch bei Tagfaltern Köderfänge durchgeführt. Nachtfalter Von den im Nordostdeutschen Tiefland ca. 800 bekannten nachtaktiven Groß- Schmetterlingsarten zeigen viele eine hohe Spezialisierung an bestimmte Nahrungspflanzen, woraus wiederum eine Gefährdung resultiert. Aufgrund dessen eignen sie sich hervorragend als Deskriptoren für die Bewertung von Strukturreichtum und Vernetzungsgrad der untersuchten Lebensräume. Bei der Erfassung von Imagines nachtaktiver Schmetterlinge kommen gewöhnlich Anlockmethoden zur Anwendung. Es handelt sich im Wesentlichen um Köder-, Pheromon- und Lichtfang. Die Fängigkeit aller diese selektiven Nachweismethoden hängt von verschiedenen methodischen, räumlichen und artspezifischen Gegebenheiten ab. Beim Lichtfang stehen der persönliche Lichtfang und der Einsatz von automatischen Lichtfallen zur Verfügung. Persönlicher Lichtfang kann mittels verschiedener Lichtquellen an Reflektorflächen oder mittels Leuchttürmen erfolgen. Beim Fallenfang ist zwischen Tötungs- und Lebendfallen zu unterscheiden. Beim Köderfang werden Köderschnüre bzw. Pinselanstriche im potenziellen Habitat ausgebracht und anschließend in regelmäßigem Abstand kontrolliert. Letztlich ist für die Arbeit mit Nachtfaltern die Präparation und das Führen einer wissenschaftlichen Vergleichssammlung unerlässlich. Heuschrecken Diese Gruppe mit in Mitteleuropa überschaubarer Artenzahl bewohnt alle Strata und ist vor allem für eine Beurteilung von Offenlandbereichen prädestiniert. Hierbei besiedeln Charakterarten sowohl trockene als auch feuchte bis nasse Extrembiotope. Da diese Gruppe artspezifisch empfindlich auf Veränderungen einzelner Parameter im Umfeld ihres Lebensraumes reagieren, eignet sie sich insbesondere zur Dokumentation möglicher Auswirkungen von Eingriffen. Für die Erfassung der Saltatoria in ausgewählten Bereichen finden drei Begehungen auf geeigneten Probeflächen bei günstigen Witterungsverhältnissen statt. Alle schon vorhandenen Daten fließen in die Auswertung ein. Die Kontrolle beinhaltet neben dem Verhören mit dem BAT- Detektor vor allem Sichtkontrollen sowie Kescherfänge. Arten, die keine oder kaum wahrnehmbare Gesänge (Dornschrecken, Eichenschrecke u. a.) äußern, werden durch Abklopfen von Büschen und Bäumen bzw. gezieltes Suchen erfasst. Laufkäfer Laufkäfer als epedaphisch (in der Streuschicht) lebende Gruppe sind eine gut untersuchte und anerkannte Bioindikatorengruppe, auf die oft bei ökologischen Untersuchungen zurückgegriffen wird. Der Bodenfallenfang ist, zumindest für epedaphische Arthropodengruppen wie die der Laufkäfer nach wie vor die günstigste Methode, um in relativ kurzer Zeit und mit vertretbarem Zeit- und Arbeitsaufwand einen annähernd genauen Überblick über den Artbestand und die Artzusammensetzung eines Gebietes zu erhalten. In Anwendung kommen Bodenfallen nach BARBER (1931). Ein im Boden verbleibender PVC- Zylinder wird mit einem Plastbecher beschickt, der das schnelle und unkomplizierte Entleeren des Falleninhaltes ermöglicht. Ein Eindringen von Regenwasser und damit ein Überlaufen der Fallen wird durch ein auf Halterungen befestigtes durchsichtiges PVC-Dach mit einem Bodenabstand von ca. 5 cm verhindert. Als Fangflüssigkeit dient Ethylenglykol. Die Bodenfallen werden je nach Standort und Problematik wahlweise in Fallengruppen zu je fünf bzw. zweimal drei Fallen angeordnet. Um eine gegenseitige Beeinflussung der Fängigkeit der Fallen zu vermeiden, werden sie mit einem Mindestabstand von mindestens 5 m voneinander aufgestellt. Eine Leerung erfolgt in einem 14-tägigen Rhythmus. Bei Lebendfallen (ohne Konservierungsflüssigkeit) wird alle drei bis vier Tage geleert. Spinnen Webspinnen sind eine anerkannte, gut erforschte Bioindikationsgruppe, die es ermöglicht in einem breiten Spektrum von Straten die Lebensraumbedingungen zu beschreiben und zu analysieren. In Mitteleuropa treten mehr als 1000 Arten mit einem hohen Anteil an stenöken Species auf. Diese hochspezialisierten Arten mit ihren artspezifischen Habitatanforderungen sind für die Bewertung von Lebensräumen und für die Eingriffs- und Raumplanung gut geeignet. Zu Erfassung und Nachweis kommen je nach Fragestellung verschiedene Methoden in Frage. Wird vor allem das epigäische (am Boden lebende) Artenspektrum betrachtet, kommt die Bodenfallenmethode (s. hierzu Laufkäfer) zum Einsatz. Die in der Kraut- und Strauchschicht lebenden Radnetzspinnen sind durch Handaufsammlungen und Sichtbeobachtungen gut zu erfassen. Eine bessere Verwertbarkeit dieser Form der Aufnahme wird durch eine semiquantitative Bearbeitung mit dem Streifnetz oder mit dem Klopfschirm möglich. Zur Abrundung des Artenspektrums können Spinnen auch am Licht als Beifänge der Schmetterlingskartierung in Lichtfallen gefangen werden. Wanzen Bekanntermaßen stellen die Wanzen in ihrer Gesamtheit weltweit die einzige Insektenordnung dar, die alle Lebensräume erobert hat. Zudem gilt sie als weltweit artenreichste hemimetabole Insektenordnung (derzeit ca. 44.000 Arten beschrieben). Ein arten- und individuenreiches Auftreten in vielen Habitaten ermöglicht eine fundierte statistische Aussage. Ein weiterer Vorteil bildet die große Agilität zahlreicher Arten. Sie sind somit in der Lage, kurzfristig sich ändernde Standortbedingungen anzuzeigen. Das Artenspektrun wird mittels Streifsack, Bodenfallen und Handauflese erfasst. Die Leerung aller Fallen erfolgt in einem dreiwöchigen Rhythmus im Zeitraum von Anfang April bis Mitte Oktober. Zusätzlich kann mit weiteren Erfassungsmethoden deren Fängigkeit ermittelt werden. So werden Fotoeklektoren, eine Malaisefalle sowie Gelbschalen gestellt und es kommt ein Klopfschirm sowie der D-Vac Sauger zur Anwendung. In witterungs-begünstigten Nächten kann zudem die Lichtfalle eingesetzt werden.
Der Juchtenkäfer
(Osmoderma eremita) - eine
Handreichung für
Planungsbüros.
Die 3. Auflage ist in
Vorbereitung.
Die Broschüre können Sie
unter www.osmoderma.info
bestellen.


- Übersicht
- Umweltverträglichkeit
- FFH-Verträglichkeit
- Artenschutzrechtliche Prüfungen
- Landschaftspflegerische Begleitpläne
- Ökologische Baubegleitung
- Managementplanung
- Monitoring und Pflegekonzepte
- Flora und Vegetation
- Avifauna
- Säugetierfauna
- Herpetofauna
- Molluskenfauna
- Entomofauna und Spinnen
- Gewässeruntersuchung




- BIOM
- Leistungen
- Übersicht
- Planungssicherheit
- Umweltverträglichkeit
- FFH-Verträglichkeit
- Artenschutzrechtliche Prüfungen
- Landschaftspflegerische Begleitpläne
- Ökologische Baubegleitung
- Managementplanung
- Monitoring und Pflegekonzepte
- Flora & Vegetation
- Avifauna
- Säugetierfauna
- Herpetofauna
- Molluskenfauna
- Entomofauna und Spinnen
- Gewässeruntersuchungen
- Schwerpunkte
- Methodik
- Referenzen
- Publikationen
- Media















